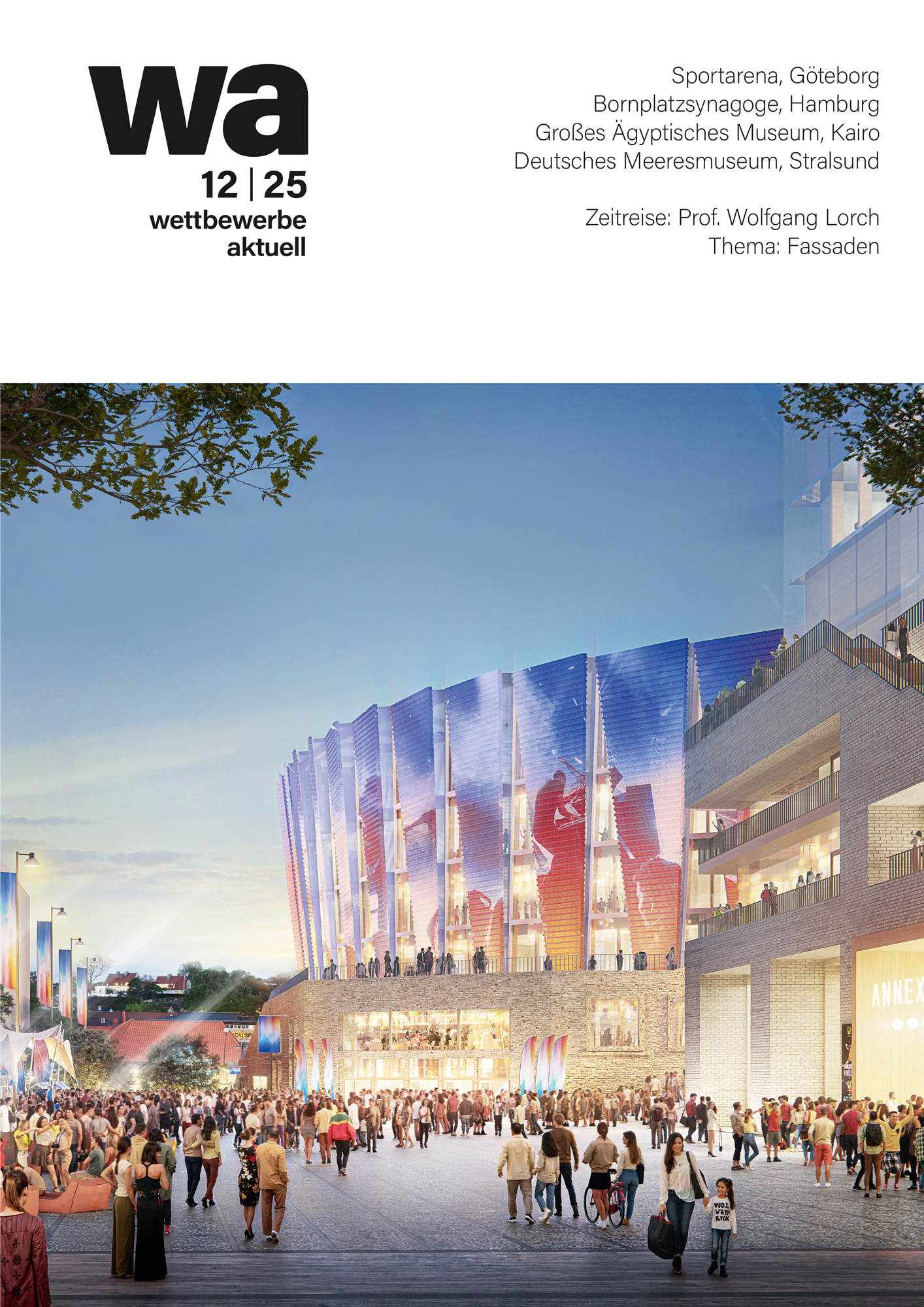Eine Zeitreise mit Wolfgang Lorch
Die sichtbare Rückkehr in die Mitte der Zivilgesellschaft mit der Trias Hauptsynagoge, Gemeindehaus und Jüdisches Museum bedeutete baulich für uns, dass diese Rückkehr keine Abgrenzung sein darf. Ein erster, ein ganz wichtiger Aspekt unseres Entwurfes. Wer schon einmal am Münchner Jakobs-Platz war, weiß: Man kann an die Gebäude herantreten, sie werden als einzelne Baukörper sichtbar. Und das war zugleich eine der eigentlichen Anforderungen der Aufgabe: Offenheit und Sicherheit gleichermaßen zu gewährleisten. Das war ein ganz starker Aushandlungsprozess. Denn natürlich muss man bei Synagogen auch immer Sicherheitsfragen mitdenken. Ben-Gurion hat mal gesagt: „Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist“ – und noch heute erscheint mir diese Offenheit unseres Entwurfs in ihrer gesellschaftlichen, in ihrer politischen Dimension das eigentlich Wichtige. Sicherheitsaspekte haben nicht zu einem Einmauern geführt, sind nicht öffentlich sichtbar geworden.
Das war auch Teil des Ringens, nicht nur der Architekten, sondern eines gemeinsamen Ringens dort, um das als angemessenen Ort in der Stadt sichtbar werden zu lassen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, man kann aus heutiger Perspektive sagen: Es ist Teil der Mitte von München geworden.
Aber kehren wir zunächst zurück, zum Wettbewerb: Das Programm intendierte nämlich eigentlich, dass man in den Gemeindenutzungen die Synagoge integriert, was nutzungstechnisch einige Vorteile gehabt hätte, aber den Nachteil ergab, dass die Hauptsynagoge nicht als bedeutendster Teil sichtbar geworden wäre, sondern sie wäre irgendein Inlay eines größeren Volumens geworden.
Wir haben sie mit unserem Entwurf und unserer eigenen Interpretation des Raumprogramms aber in der Mitte des neuen Jakobs-Platzes verortet: als einen relativ kleinen, aber wichtigen Baukörper – was, nebenbei bemerkt, zugleich auch noch eine andere Problemstellung löste, nämlich dass die Synagoge geostet sein muss. Darüber hinaus hat die Besetzung der Mitte auch eine symbolische Bedeutung: mitten in der Zivilgesellschaft. Ich glaube, es wäre eine Niederlage, sie aus dem engeren Stadtkontext herauszulösen und damit das Bild zu erzeugen, dass sie per se so nicht integrierbar ist

Mit den anderen Baukörpern steht die Synagoge heute über eine korrespondierende Formensprache und Materialität in Verbindung. Der massive, hermetisch geschlossene Sockel aus gespaltenem Travertin der Synagoge ist eine Metapher für den Tempel in Jerusalem, die filigrane Konstruktion des Zeltes übernimmt komplementär dazu die Metapher des Stiftzeltes. Bei dem Museum dreht sich das um: Hier ist die Eingangszone offen und darüber liegend der geschlossene White Cube der Ausstellungsräume. Das Komplementäre bezieht sich demnach zunächst auf den Baukörper, auf die Baukörperordnung, wir haben an diesem Ort ja eine ganz besondere städtebauliche Körnigkeit, dann aber auch bezogen auf die Materialität, wo verschiedene Oberflächen eines Materials (der gebrochene und der geschliffene Stein) je eine andere Logik besitzen.

Jenseits all der bisher genannten Aspekte ging es uns aber auch darum zu überlegen, wie man den Typus Synagoge neu interpretiert. Dazu sollte man wissen, dass der Synagogenbau in Deutschland zwischen der Freizügigkeit der Juden ab der 1830er-Jahre bis zu ihrem Ende durch die NS-Diktatur auch der Irrweg einer falschen Assimilation war: Zu jener Zeit übernahm man bewusst christliche Bautypen, eindringlich sichtbar bspw. bei der Semper-Synagoge in Dresden, überspitzt formuliert im Grunde eine neoromanische Kirche mit Davidstern auf den Kuppeln. Die Botschaft dahinter war sicherlich: Wir wollen uns assimilieren, wir wollen deutsch sein.
Ich glaube, nach dem Holocaust ist das aber nicht mehr die Position, die zu bauen ist. Assimilation ist nicht das Thema, sondern Übertrag und Neuanfang. Zugleich, und das ist die Dualität, besteht der Sinn im Hausbau ja darin, etwas Bleibendes zu schaffen: „Wer ein Haus baut, möchte bleiben“. Diese Dualität zwischen dem massiven Tempel einerseits und einem Volk auf Wanderschaft, einem deportierten Volk, andererseits war das Thema für uns, das wir als symbolhafte Vision baulich darstellen wollten. Ich erinnere mich gerade daran, wie bei der Einweihung die damalige Vorsitzende der Gemeinde, Charlotte Knobloch, Paul Celan zitierte und sagte: „Jetzt können wir die Koffer auspacken“.
Vor dem Hintergrund der Geschichte war uns diese Symbolik in Kombination mit einer größtmöglichen Offenheit, die wiederum ja auch ein Symbol ist, sehr wichtig.
Betrachtet man abschließend die Entwicklung seit der Realisierung 2005 bis heute und wagt einen Ausblick, so vermute ich, dass vor zwei Dekaden die Rekonstruktion als nicht angemessen gegolten hätte. Das ist wahrscheinlich ein Unterschied zu heute (vgl. Bornplatzsynagoge, Hamburg, wa-2038536). Freilich ist der Wunsch nach Rekonstruktion in seinem Sehnsuchtsanspruch ein legitimer – und bezogen auf christliche Kirchen sicherlich auch ein gut denkbarer: Ich denke da beispielsweise an die Dresdner Frauenkirche, gleichermaßen ein Gotteshaus wie auch Symbol des Wiederaufbaus einer zerstörten Stadt. Bezogen auf eine Synagoge in Deutschland ist das allerdings eine nicht ganz einfache Position: Die zwischen den Jahren 1933 und 1945 zerstörten Synagogen nun unkritisch wieder aufzubauen, würde die gewaltige Zäsur der Geschichte nicht mitreflektieren. Da frage mich: Was würden diese Häuser erzählen, wenn sie sprechen könnten?
Wolfgang Lorch, November 2025

Wolfgang Lorch
Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Lorch wurde 1960 geboren. Er studierte Architektur an der TH Darmstadt sowie der Escuela Technica Superior de Arquitectura Barcelona.
Seit 2001 ist er ordentlicher Professor; zunächst in Stuttgart, seit 2003 an der TU Darmstadt.
Mit seinem Architekturbüro Wandel Lorch Götze Wach (vormals Wandel Hoefer Lorch) realisiert er seit den 1990er-Jahren Großbauten in ganz Europa. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Bau von Synagogen, Museen und Ausstellungsgebäuden, Kurhäusern und Hotels.
Unter den zahlreichen Auszeichnungen für seine Arbeiten finden sich der World Architecture Award (2002), der Deutsche Städtebaupreis (2008) oder der Hessische Kulturpreis (2019) sowie mehrfache Anerkennungen beim Deutschen Architekturpreis.
Er ist Mitglied und Vorsitzender in diversen Architekturjurys, Mitglied des Gestaltungsbeirats der Städte Pfullingen und München sowie Vorsitzender der Stiftung Baukultur Saar.
Wandel Lorch Götze Wach
www.wlgw.de